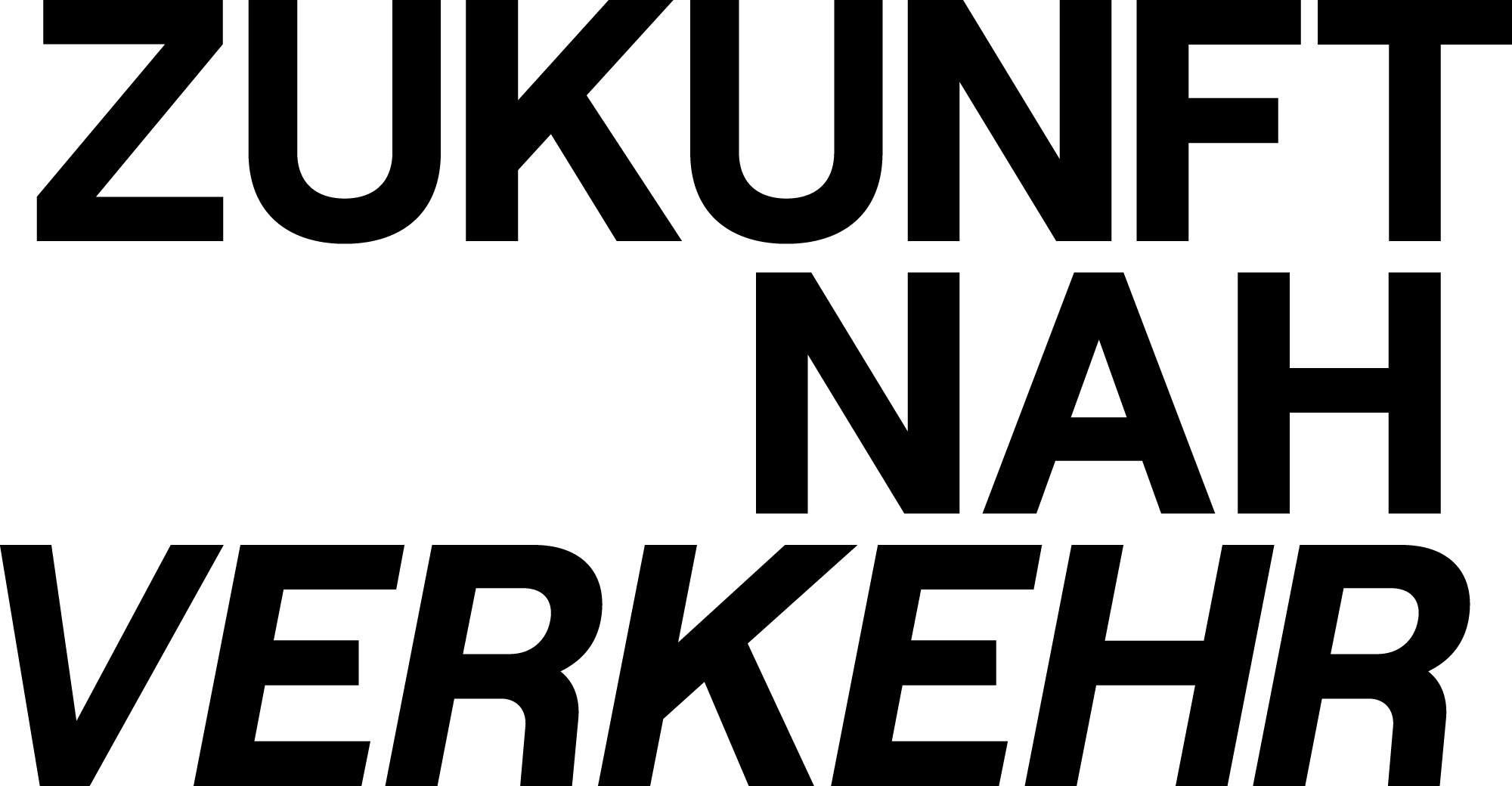Artikel: „eTarife passen gut in die Zeit“
Schlägt nach der Einführung des Deutschland-Tickets die Stunde der eTarife? Zukunft Nahverkehr hat bei Martin Schmitz, Geschäftsführer Technik beim VDV, nachgefragt.
Zukunft Nahverkehr: Herr Schmitz, vor fünf Jahren mussten Verbünde noch Testkunden für den E-Tarif suchen. Heute sind sie im Alltag angekommen. War das jetzt schnell oder eher langsam?
Martin Schmitz: Tempo gehört nicht unbedingt zu den größten Stärken, die der ÖPNV in den festgelegten Strukturen bieten kann. Alles, was Tarife betrifft, muss von Fach- und politischen Gremien abgesegnet werden, und wenn es um Digitalisierung geht, prallen oft unterschiedliche Philosophien aufeinander. Der Wechsel von den herkömmlichen zu digitalen Tarifen wird sehr intensiv diskutiert, weil Themen wie Check in/Check out immer noch häufig mit Tracking und Datenschutzproblemen assoziiert werden. Das ist aber eine Mähr, weil nur Ticketnummern getrackt werden und die Zuordnung zum Fahrgast erst bei der Abrechnung durch einen sehr engen Personenkreis erfolgt. Zu kurz kommt dabei oft der Vorteil dieser anonymisierten Datenerhebung: Die Branche könnte ihre Angebote passender am tatsächlichen Nutzerverhalten ausrichten.
Zukunft Nahverkehr: Der eTarif ist aus dem eTicket heraus entstanden, das entwickelt wurde, um unter anderem verbundübergreifende Fahrten mit dem ÖPNV zu ermöglichen. Mit dem Deutschland-Ticket in der Hand scheint das im Rückblick fast visionär. Geblieben ist hingegen die Debatte um die Aufteilung der Einnahmen.
Martin Schmitz: Beim Deutschland-Ticket haben wir einen deutschlandweit gültigen Tarif, von dem wir aber nicht wissen, wo genau die Kunden damit fahren. Solange wir aber nicht wissen, wo unsere Kunden unterwegs sind, können wir die Einnahmeaufteilung nur auf Grundlage theoretischer Modelle, Fahrgastzählungen oder ähnlichem durchführen. Wüssten wir konkret, wo unsere Kunden mit welchen Bussen, S-Bahnen und U-Bahnen unterwegs sind, ließen sich die Einnahmen auch nutzungsabhängig verteilen. Damit hätten die Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Verbünde die Chance, bei den Angeboten nachzusteuern. Deshalb geht es gerade einerseits um die Erleichterung des Zugangs zum ÖPNV-System für unserer Kunden, andererseits aber auch um die Frage, wie wir beim Deutschlandticket Nutzungsdaten für eine Aufteilung der Einnahmen ermitteln können. Check-in/Check-out-Systeme böten sich da als eine mögliche Lösung an.Zukunft Nahverkehr: Würde das funktionieren? Wir haben schließlich alle verinnerlicht, dass es genügt, das Deutschland-Ticket auf Chip oder Smartphone dabeizuhaben.Martin Schmitz: Wenn es sich im Einklang mit der IT-Sicherheit und dem Datenschutz automatisiert im Hintergrund erledigen lässt, sollten wir das meiner Meinung nach auch in Deutschland hinbekommen. Auch, wenn wir da als öffentlicher Dienstleister zurecht erhöhten Anforderungen unterliegen.
Zukunft Nahverkehr: Das wäre dann die nächste Anwendungsvariante. Mancherorts können Kunden inzwischen auch schon zwischen luftlinien- und wabenbasierter Preisermittlung wählen. Ist diese Vielfalt noch Segen der Digitalisierung oder eher schon wieder alter Wein in neuen Schläuchen? Martin Schmitz: Prinzipiell können Sie digital fast alles umsetzen. Betriebswirtschaftlich betrachtet ist es aber eine zweischneidige Angelegenheit. Je mehr Varianten es gibt, um so komplizierter wird es für die Kunden und umso komplexer wird die Software dahinter. Wenn ich zum Beispiel einen Entfernungstarif einführe und den Wabentarif beibehalte, drückt sich darin eben auch mangelnde Entscheidungsfreudigkeit aus. Denn bei einem Tarifwechsel gibt es immer Gewinner und Verlierer, was Diskussionen mit Bürgern, Bürgerinnen und Fahrgästen nach sich zieht. Indem man beides ermöglicht, vermeidet man sie. Das lässt sich operativ und technisch zwar alles umsetzen, aber zum Schluss fährt man mit einem eindeutigen Modell besser. Das ist nicht nur wirtschaftlicher für Unternehmen und Verbünde, sondern gibt den Kunden auch das Gefühl, dass sie die angebotenen Tarife nicht jedes Mal hinterfragen und prüfen müssen. Die eTarife passen ja vor allem deshalb so gut in die heutige Zeit, weil man sie digital nutzen, berechnen und vernetzen kann. Deshalb bieten sie maximale Flexibilität und funktionieren auch ganz unkompliziert über Verbundgrenzen hinweg. Da müssen wir hinkommen. Zukunft Nahverkehr: Inzwischen kommen die ersten Verbünde mit Best-Price-Angeboten wie „Teurer als das D-Ticket wird es nicht“ um die Ecke. Klingt in meinen Ohren wie ein Deutschlandticket light, das sich als Gelegenheitsnutzer-Tarif tarnt.
Martin Schmitz: Wenn ein Kunde sich entscheidet, Einzeltickets zu kaufen, dann geht das für das Verkehrsunternehmen mit höherem vertrieblichen Aufwand durch Buchungen, Ticketkontrollen, möglicherweise auch Bargeldhandling und ähnlichem einher. Wenn der Kunde diese Option im Monat zehnmal nutzt, kostet das also mehr, als wenn er einmal ein Deutschlandticket kauft. Da frage ich mich schon, warum man die Ausgaben ab einem bestimmten Betrag deckelt. Das finde ich persönlich aus unternehmerischer Sicht unnötig. Denn der Kunde sollte selbst entscheiden, ob er durch eine günstigere Flatrate sparen oder durch Einzelkäufe, die in Summe mehr kosten können, flexibler sein möchte. So ist es in anderen Branchen und bei anderen Produkten ja auch. Letztlich hängt das von der Frage ab, ob man beim ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge automatisch immer die minimale Kostenbelastung der Kunden im Blick haben sollte. Wenn das politisch so gesehen wird, dann muss allerdings der Ausgleich für entgangene Einnahmen bei den Verkehrsunternehmen über die öffentlichen Haushalte finanziert werden.
Zukunft Nahverkehr: Kann es sein, dass es um das Deutschlandticket langsam ruhiger wird und die Musik jetzt eher in der Debatte um die Neuordnung der darunter angeordneten Tarifsegmente spielt?
Martin Schmitz: Absolut. Deutschland ist in diese Tarifrevolution gestartet, indem es die Tarife mit dem Deutschland-Ticket gedeckelt hat. Darunter müssen nun Tarife geschaffen werden, die dem Fahrgast einen Mehrwert bieten, der Branche aber auch zusätzliche Einnahmen ermöglichen. Deshalb müssen Tariflandschaften nun neu gedacht und angepasst werden. eTarife unterstützen diesen Weg zusätzlich, denn digital ist in diesem Fall einfacher als analog. Als Aufgabenträger und Verbund bekomme ich damit ein komplett neues Paket, das ich politisch, verkehrspolitisch, sozialpolitisch und verkehrstechnisch bewerten muss, um entscheiden zu können, wo und wie der Zugang zum System und die Attraktivität des ÖV gestaltet und finanziert werden kann.
Zukunft Nahverkehr: Es gibt auch Stimmen, die argumentieren, dass das Ergebnis den Aufwand nicht rechtfertigt und die stattdessen dafür plädieren, das Deutschland-Ticket zu einem Bürgerticket weiterzuentwickeln. Das soll dann allen zustehen und durch Umlagen – etwa über Drittnutzer – finanziert wird. Was halten Sie davon?
Martin Schmitz: Ehrlich gesagt nicht so viel. Wenn das auch mit Inflationsausgleich verbunden wäre, dann hätte das zwar den Vorteil, dass das Geld quasi automatisch käme und uns die ganze Ticketpreisdiskussion nicht mehr treffen würde. Andererseits leben wir in einer Marktwirtschaft und wir vertreten schon die Position, dass der ÖV im Wettbewerb zum Auto steht und die Menschen durch gute Angebote motivieren muss, den ÖPNV zu nutzen. Und das hat nicht nur was mit Ticketing zu tun, sondern auch mit Betriebsqualität, Zustand der Infrastruktur, Arbeitsbedingungen. Wir müssen an vielen Stellen besser werden, moderner, digitaler und attraktiver. Das alles kann nicht allein aus den immer knapperen Haushaltsmitteln von Bund, Ländern und Kommunen finanziert werden. Diejenigen, also unsere Fahrgäste, die von einem leistungsstarken und modernen Nahverkehr profitieren, sollen dafür auch einen fairen, aber angemessenen Preis zahlen.