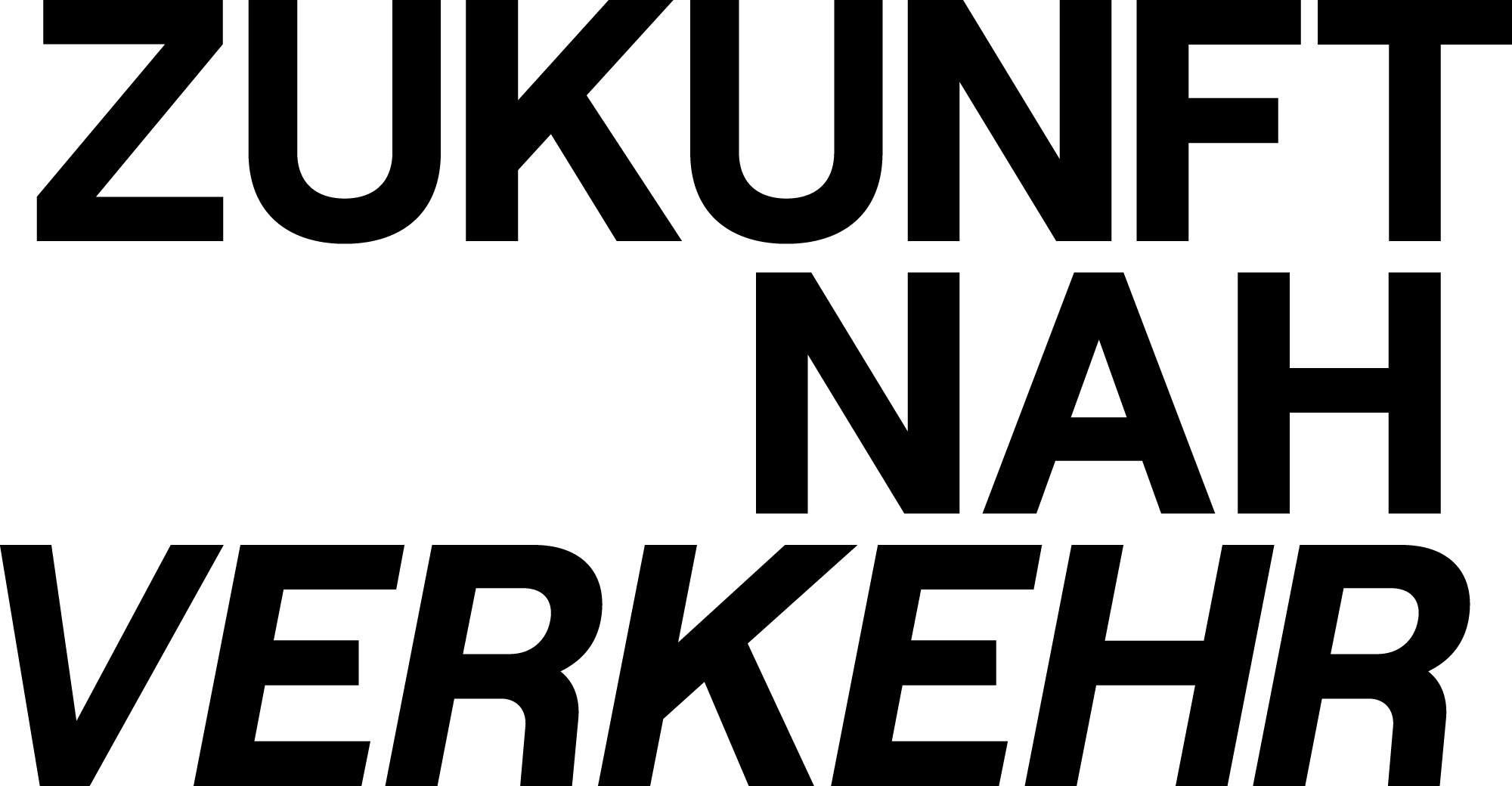Artikel: Falscher Fokus, riskante Debatte
Die Deutschland-Ticket-Bilanz der Hochschule RheinMain zeigt, warum der Fokus auf Finanzierung den Blick fürs Wesentliche verstellt und höhere Preise keine Lösung sind.
Seit anderthalb Jahren ist es auf dem Markt, dreizehn Millionen Menschen haben es in der Tasche und im Wahlkampf mischt es auch schon mächtig mit: Das Deutschland-Ticket ist mitten im Leben angekommen, die Debatte zwischen Befürworter- und Skeptiker:innen immer noch für Schlagzeilen gut.
Geht es nach Andreas Krämer, Professor für Preis- und Kundenwertmanagement an der University of Applied Sciences Europe in Iserlohn und CEO der exeo Consulting Strategy AG, hat die Debatte aber gewaltig Schlagseite: „Das Thema Finanzierung überschattet die ganze Evaluierung, weil es nur noch um die Kosten geht“, kritisierte er bei der Veranstaltung „Mobilität für alle? Die Bilanz des Deutschland-Tickets ein Jahr danach“, zu der die Hochschule RheinMain geladen hatte.
Krämer, der jüngst das Buch "New Mobility – vom 9-Euro-Ticket zur Verkehrswende? Umsetzung, Wirkungen und Herausforderungen für den ÖPNV in Deutschland“ veröffentlicht hat, plädiert stattdessen dafür, das Ticket als Investition zu betrachten. „Im Kern geht es darum, wie viel Nachfrage wir mit dem Deutschland-Ticket für das System Nahverkehr gewinnen können und wie sich diese zwischen induzierter und verlagerter Nachfrage aufteilt.“ Daran, so Krämer, könne man die wesentlichen Evaluationsthemen beim Deutschland-Ticket festmachen.
Das hat er offensichtlich auch getan und die Antwort gleich mitgebracht: Ergebnisse aus drei exeo-Studien vom Herbst 2023 bis Juli 2024 zeigen nicht nur, dass das Deutschland-Ticket größtenteils für kürzere Distanzen verwendet wird. Sie weisen auch nach, dass der Mehrverkehr im ÖPNV im Wesentlichen von Personen generiert wird, die mit dem Deutschland-Ticket erstmals ein Abo-Ticket erworben haben und nun den PKW öfter stehen lassen.
„Wenn wir über das Thema Verkehrswende und -verlagerung sprechen, ist das die zentrale Gruppe, die wir neu in das System reingeholt haben – nicht in das System Nahverkehr, aber in das System des Abos und der Zeitkarte. Da ist der Wirkungsmechanismus, das ist des Pudels Kern bei der Bewertung des Deutschland-Tickets,“ sagt Krämer. Die im ersten Jahr erzielte Minderung der CO2-Emissionen um rund drei Millionen Tonnen erwähnt er hingegen eher beiläufig. Sie sind ein Teil der insgesamt verminderten externen Kosten des Autoverkehrs.
Viel wichtiger ist ihm der Hinweis darauf, dass die Kosten-Nutzen-Analyse beim Deutschland-Ticket schon jetzt ein positives Saldo ergebe, wenn man es aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive betrachte. Saldiere man Kundennutzen, entfallene externe Kosten des PKW-Verkehrs und induzierte Wertschöpfung in Handel und Gastronomie mit den Einnahmeverlusten von ÖPNV und Fernverkehr, erziele das Deutschland-Ticket einen volkswirtschaftlichen Nutzen von mindestens 1,7 Milliarden Euro jährlich, rechnet Krämer vor. Bei optimistischen Annahmen kann der Netto-Nutzen leicht doppelt so hoch sein.
Mit Blick auf die immer wieder aufflammende Diskussion um weitere Preiserhöhungen rät er trotz hoher Einnahmeverluste bei Verkehrsunternehmen und Verbünden zu Vorsicht. „Wir dürfen die Nutzer:innen des Deutschland-Tickets nicht mit Ultra-Heavy-Usern gleichsetzen und nicht alle geben jetzt weniger aus als vorher“, mahnt er. Vielmehr hätten bis zu 40 Prozent der Abonnent:innen weniger als 49 Euro monatlich für den Nahverkehr ausgegeben, bevor sie in das Deutschland-Ticket gegangen seien.
Krämer: „Das sind die Leute, die neu ins System eingestiegen sind, nicht kannibalisieren und für das System günstig sind, weil sie es besser finanzierbar machen. Wenn das Deutschland-Ticket irgendwann 88 Euro kostet, werden sie das System aber wieder verlassen und der Effekt kollabiert.“